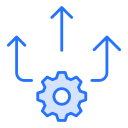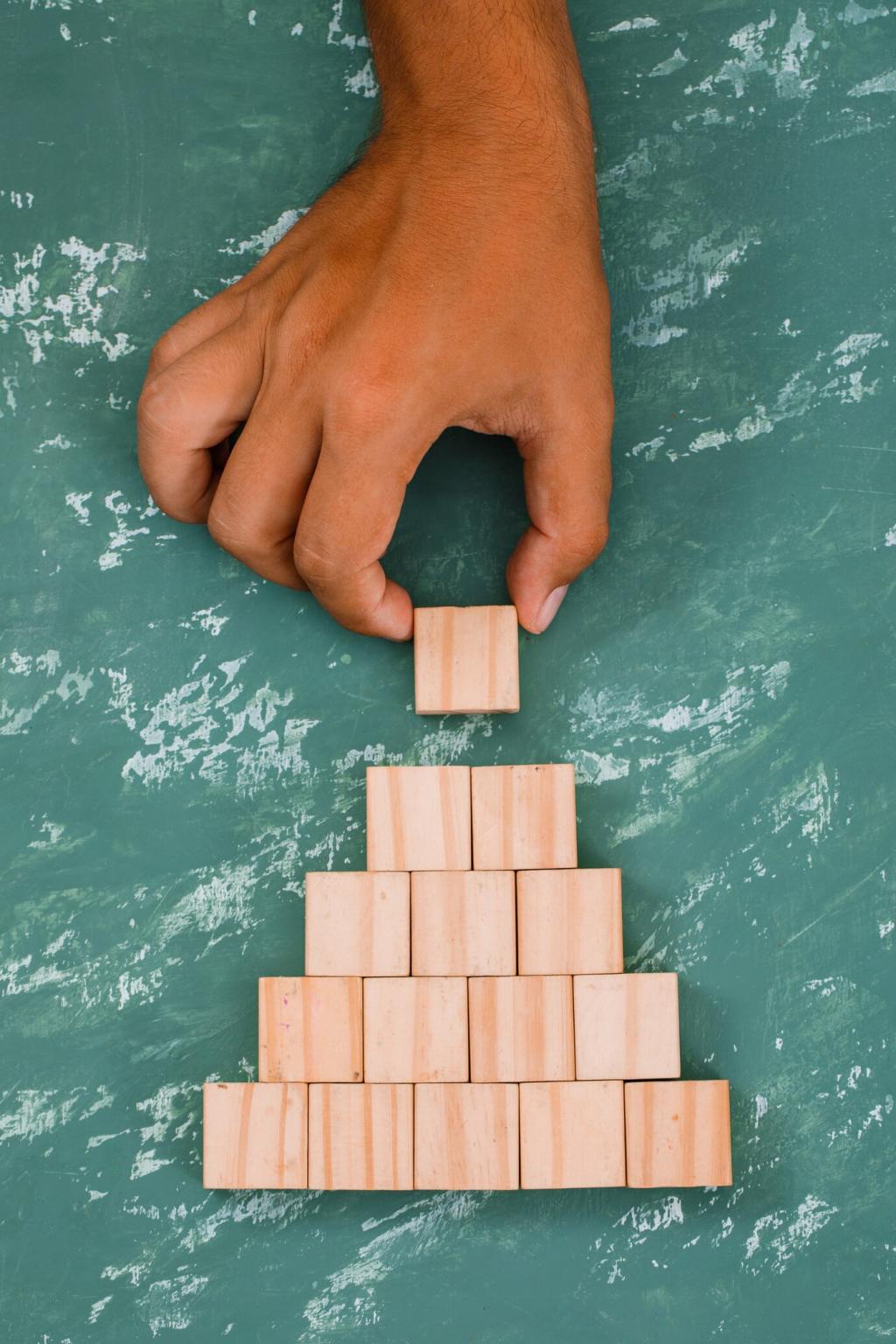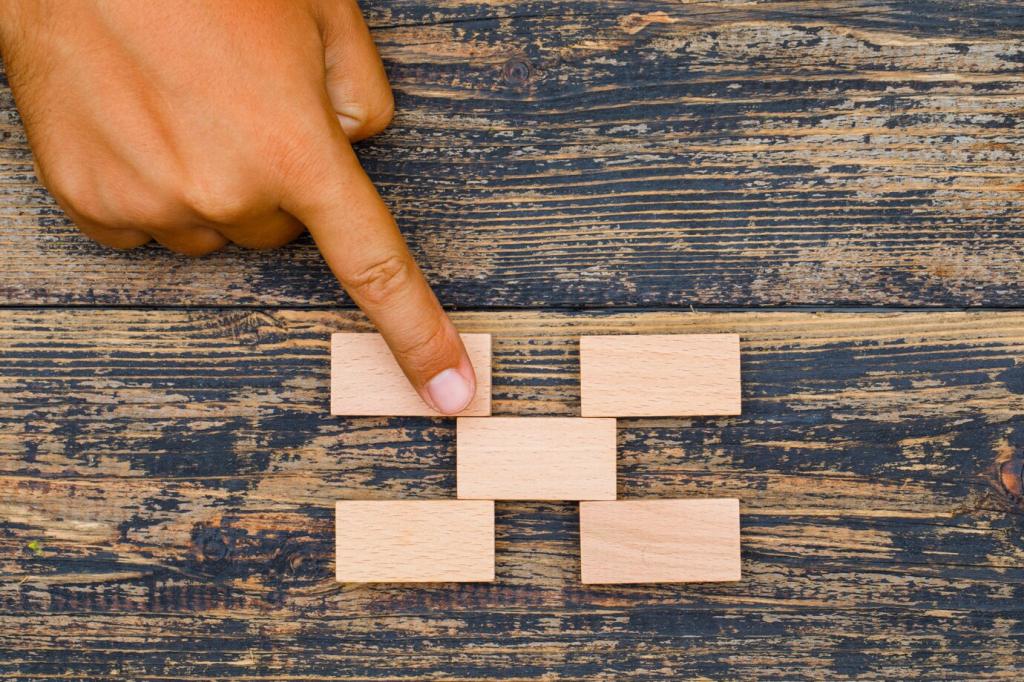Entscheidungshilfe: Wann Low-Code, wann No-Code?
Klar definierte Prozesse ohne Speziallogik? Starte mit No-Code. Komplexe Regeln, Integrationen, Qualitätssicherung oder Domänenlogik? Wähle Low-Code. Berücksichtige Compliance, Skalierung und Teamkompetenzen für eine belastbare Entscheidung.
Entscheidungshilfe: Wann Low-Code, wann No-Code?
Begrenze Umfang, lege Erfolgskriterien fest, plane Datenqualität und Tests. Sammle Nutzerfeedback früh und dokumentiere Lernpunkte. So entscheidest du faktenbasiert, ob du ausweitest, kombinierst oder neu priorisierst.